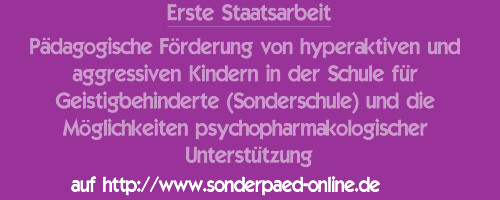
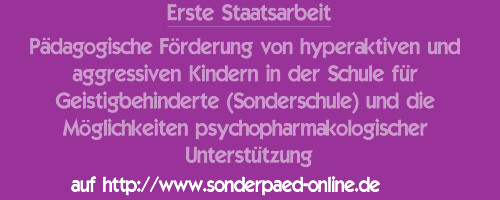
7. Ausblick
Zuletzt bleibt die Frage, wie sich die Ergebnisse dieser Arbeit in der praktischen Tätigkeit des Sonderpädagogen anwenden lassen.
Jedem Pädagogen muss klar sein, dass erst nach einer fachgerechten Bestandsaufnahme der Probleme und Ressourcen eines auffälligen Schülers (Kurzdiagnose etc.) ein sinnvolles pädagogisches Konzept erstellt werden kann.
Die teilweise unterschiedlichen Erklärungsansätze für die Entstehung der jeweiligen Verhaltensauffälligkeit bedingen verschiedene Interventionsformen, wobei der Pädagoge sich durch Herantasten der optimalen Interventionsmaßnahme nähert und gleichzeitig der Ursachenfindung zuträglich ist.
Da eine dermaßen intensive Beschäftigung mit den einzelnen Schülern sehr zeitaufwendig ist, ist die Intensivpädagogik auf die Anwesenheit von 2 Lehrern in der Klasse angewiesen.
Reichen die pädagogischen Interventionsmaßnahmen nicht aus, um bei dem betroffenen Kind einen Abbau der Verhaltensauffälligkeit zu bewirken, ist es die Aufgabe eines Pädagogen, die Eltern auf die Möglichkeit einer unterstützenden (Psycho-) Pharmakotherapie hinzuweisen und ihnen einen Arztbesuch nahe zu legen. Anzuraten ist den Eltern der Besuch eines Neuropädiaters, da dieser die entsprechenden Fachkenntnisse in Bezug auf eine Anwendung von Psychopharmaka bei Kindern mit einer geistigen Behinderung aufweist. Die Ergebnisse der Untersuchung von MEINER (siehe Kapitel 5.3) zeigen, dass die Behandlung dieser Kinder nach wie vor in den Händen von Allgemeinärzten liegt, die in der Regel nicht über die entsprechenden Qualifikationen verfügen dürften.
Im Umkehrschluss muss der Pädagoge über die medizinischen Maßnahmen, sprich Psychopharmakotherapie, informiert werden, da nur er in der Lage ist, unter den besonderen Bedingungen des schulischen Alltags, positive und negative Auswirkungen zu erkennen und zu beschreiben. Eine Zusammenarbeit von Eltern, Pädagogen und Arzt ist im Sinne eines Gesamtbehandlungsplans unumgänglich.
Wird die oben beschriebene Einbeziehung von Medizinern unterlassen, so kommt es in manchen Fällen schnell zu einer Hilflosigkeit der Pädagogen. Wie weit diese Hilflosigkeit gehen kann, zeigen Interventionsmaßnahmen, wie z.B. der elektroaversiven Reizung oder dem Einsatz aversiver Geruchsreize (siehe Kapitel 4.5.2: Strafverfahren - Aversive Maßnahmen), die allesamt menschenverachtend und somit abzulehnen sind.
Zudem werden Selbständigkeit und Kommunikationsfähigkeit durch solche Maßnahmen unterdrückt, obwohl diese Eigenschaften statt dessen gefördert werden sollten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass alle sinnvollen Interventionsformen sowohl die Kommunikationsfähigkeit als auch die Selbständigkeit zum Ziel haben, da gerade ein Mangel an diesen oftmals für Verhaltensauffälligkeiten verantwortlich gemacht werden können oder deren Entstehung zuträglich sind.
Besondere Anforderungen an den Pädagogen stellt die Autoaggression. Bei der Beschäftigung mit diesem Thema fiel auf, dass konkret für den schulischen Bereich nur wenige Interventionsformen vorliegen, genauso wenig wie es hier spezielle Medikamente gibt.
Wünschenswert für die Zukunft wäre außerdem eine intensivere Beschäftigung der Forschung mit diesem Thema, in deren Rahmen unter anderem aktuelle Untersuchungen bezüglich der Prävalenz der beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten speziell beim Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung durchgeführt werden sollten.
Außerdem könnten empirische Arbeiten den Erfolg oder Misserfolg der Kombination von Intensivpädagogik und Psychopharmakotherapie belegen. Auf dieser Grundlage besteht die Möglichkeit des Ausbaus vorhandener oder der Entwicklung neuer Behandlungskonzepte für diese Personengruppe.