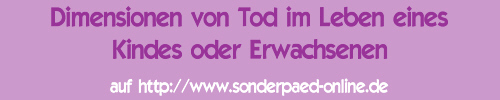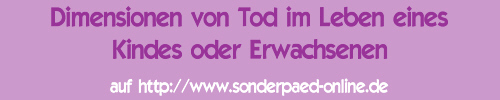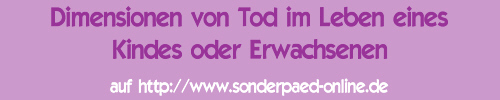
Inhalt
1. Einleitung
2. Kinder und Tod
3. Erwachsene und Tod
4. Die Bibel im Umgang mit dem Tod
5. Trauer
6. Krankheit und Tod
7. Abschließende Gedanken
8. Literatur
1. Einleitung
- Tod betrifft das Leben jeden Menschens
- vielfältige Einstellungen
- für Erwachsene ist es möglich eigene Gedanken
und Bilder anzulegen
- Wichtigkeit der Selbstreflexion
- Kinder sind angewiesen auf Erwachsene
- Problematik verschiedener Modelle: Verwirrung
- zuerst über kognitive Fähigkeiten des Kindes
informieren
2. Kinder und Tod
2.1 Kontakt der Kinder mit dem Tod
Anlässe zur Auseinandersetzung Kinder und Jugendlicher
mit dem Tod
Früher:
- Kinder erlebten in der Regel den Tod von Verwandten
und Freunden häufig
- viele Kinder erlebten auch den Tod von Geschwisterkindern
- Tod im Krankenhaus als Ausnahmesituation
- Sterbeprozess der Großeltern wurde mit erlebt
Heute:
- Sterben und Tod wird aus der Gesellschaft verbannt
- nur noch wenige Gruppen haben direkt mit dem Tod
zu tun
- erste Erfahrung mit dem Tod ist in der Regel der
Tod eines Haustiers
- auch Kinder, die nie direkt mit dem Tod konfrontiert
waren, haben Vorstellung davon, wie es ist, einen lieben Menschen zu verlieren
- Gefälle des Todesbewusstseins von der höchsten
zur niedrigsten Altersstufe
Unterschiedliche Verlusterfahrungen von Kindern
Elternteil
- starke emotionale Belastung: Schock
- kennzeichnet gesamten weiteren Lebensweg
- existentielle Gefühle wie Verlassenheit und
Bedrohung
- Zurückweisung durch überlebenden Elternteil
- Versuch, Elternteil zu ersetzen
- Schuldgefühle bei Ablösungsprozess
- Schuldgefühle durch aggressive Phantasien und
Vernachlässigungsgefühle
- je reifer kognitive und psychische Konstitution des
Kindes, um so größer ist die Chance, dass Kinder keinen bleibenden
Schaden erleiden
Haustier
- oftmals erste Verlusterfahrung
- Beziehung kann sehr innig sein
- Trauerreaktion wie bei Tod eines Menschen möglich
Geschwister
- Ambivalenz: Verlust eines Gefährten/ Rivalitäten
- erleben hilflose Eltern: Verunsicherung
- fühlen sich zurückgewiesen, ungeliebt,
wertlos
- Schuldgefühle
- Umwelt reagiert in der Regel nur auf die Eltern
Großeltern
- bei sehr enger Bindung kann die Reaktion sehr stark
sein
- Kinder erleben eigenen Verlust und zusätzlich
die Betroffenheit der Eltern: Verunsicherung
Freund
- eigener Tod rückt erstmalig in das Blickfeld
2.2 Entwicklung des kindlichen Todesverständnisses
Entwicklung des Todeskonzepts nach Piaget
- sensomotorische Phase: kein Verständnis des
Todes
- prä-operationale Phase (ab 1./2. Lebensjahr):
Egozentrismus (eigener Tod ist nicht vorstellbar)
- konkret-operationale Phase (ab 5./6. Lebensjahr):
einzelne Elemente des Todeskonzepts werden verstanden
- formal-operationale Phase (ab 12. Lebensjahr): Todesverständnis
manifestiert sich
Entwicklung des Todeskonzepts nach Tausch-Flammer 1995
0-3 Jahre
- können Tod nicht begreifen
- sprechen von Toten als wären sie noch am Leben
- kurze Abwesenheit wird mit Tod gleichgestellt
3-5 Jahre
- stellen viele Fragen
- machen erste Äußerungen zum Thema Tod
- Tod betrifft nur andere
- Tod ist vorübergehend
5-9 Jahre
- sehen den Tod realistischer
- Gefühl der Trennung und des Schmerzes
- Personifizierung des Todes
10-14 Jahre
- Tod als unausweichliches und abschließendes
Ereignis
- Gefühle wie Trennung, Liebesverlust und Endgültigkeit
werden assoziiert
- körperliche Symptome beim Tod eines nahestehenden
Verwandten
2.3 Todesangst
- entwickelt sich mit dem Todesverständnis
- natürliches Gefühl
Entwicklungsstufen bis zur Todesangst nach Braun 1976
(Bodarwe 1989)
- Trennungsangst
- Mutilierungs-/ Kastrationsangst
- Todesangst
2.4 Notwendigkeit der didaktischen Umsetzung
- Kindern den Tod nahe bringen
- Absprache zwischen Elternhaus und Schule notwendig,
um Verwirrung zu verhindern
Möglichkeiten der Informationen über den
Tod nach Bodarwe 1989
- religiös gefärbte, konventionelle Bilder
(Himmel und Hölle, Tote als freundliche Engel)
- aufklärerisch geprägte, realistische Informationen
über den Verlauf und die Folgen des Sterbens und die Bestattung
- magisch gefärbte Bilder des Aberglaubens (Totenvogel,
Schwarzer Mann)
Umgang mit dem Thema "Tod" in verschiedenen
Altersstufen nach Thiede 1994
Kindergarten
- kindliches Reden von der Auferstehungshandlung Gottes
- mit steigender kognitiver Entwicklung höhere
Stufen des Verständnisses der Auferstehung erreichen
frühe Grundschule
- auf Frage nach dem Verbleib der Toten: Schlafen nach
dem Zerfall der irdischen Hüllen in Gottes Hand bis zur Auferweckung
späte Kindheit
- Alternative der christlichen Auferstehungshoffnung
zu Transzendenzstreben der spiritualistischen Auffassung und zu Realismus
der materialistischen Auffassung
- christliche Hoffnung als ganzheitliche Hoffnung
Pubertät (10-14)
- Streben nach Individualisierung: Sinnfrage
- Antwort auf Sinnfrage ist endgültiger Sieg Jesu
über den Tod
Jugendliche
- Beschäftigung mit verschiedenen Ideologien (religiöse,
materialistisch-positivistische oder spiritualistisch-esoterische)
- Darstellung des christlichen Glaubens unter Betonung
seiner weltanschaulichen Konturen (damit er ideologiekritischer wirkt)
3. Erwachsene und Tod
3.1 Das Verhältnis des modernen Menschen
zum Tod
- Tod ist aus dem Gesichtsfeld verschwunden, Institutionalisierung
- Isolierung alter Menschen
- Gefälle des Todesbewusstseins
3.2 Bedingungen des reifen Todeskonzepts
Komponenten eines reifen Todeskonzepts (Kübler-Ross)
- Universalität (jeder Mensch muss sterben)
- Irreversibilität (Tod ist endgültig)
- Non-Funktionalität (alle notwendigen Körperfunktionen
haben aufgehört)
- Kausalität (Verständnis der Todesursache)
4. Die Bibel im Umgang mit
dem Thema
Tod
Todes-Thematik in der Bibel nach Jüngel 1993
Altes Testament:
- Leben ist das höchste Gut
- Tod bedeutet Gottesferne, Gott vergißt einen
- Tod als Gottesstrafe
- erste Auferweckungsgedanken
Belege:
- Abrahams (Genesis 25, 7-11) und Jakobs Tod (Genesis
49, 29 ff) werden sehr nüchtern beschrieben
- Der Herr tötet und macht lebendig (1. Samuel
2, 6)
- ... die im Grabe liegen, deren du nicht mehr
gedenkst und die von deiner Hilfe geschieden sind. (Psalmen 87, 6)
- Denn wir vergehen durch deinen Zorn. (Psalmen
90, 7)
- Deine Toten werden leben, werden auferstehen;
aufwachen und jubeln werden die Bewohner des Staubes. (Jesaja 26, 19)
- ... aber der Herscher der Welt wird uns, wenn
wir für seine Gebote gestorben sind, zu einem neuen, ewigen Leben
auferwecken. (2. Makkabäer 7, 9)
Neues Testament:
- Auferstehungshoffnung steht im Vordergrund
- Tod und Gott sind Feinde, Gott besiegt den Tod/ Teufel
Belege:
- Wach auf, der du schläfst, und steh auf
von den Toten, so wird Christus dir als Licht aufgehen. (Epheserbrief
5, 14)
- Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort
hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben,
und in ein Gericht kommt er nicht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben
hinübergegangen. (Johannes 5, 24)
- Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt;
und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben.
(Johannes 11, 25-26)
- Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gnadengabe
Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. (Römerbrief
6, 23)
- Als letzter Fein wird der Tod zunichte gemacht.
(1. Korintherbrief 15, 26)
- ... damit er durch den Tod den zunichte machte,
der die Macht üner den Tod hat, das heißt: den Teufel, ...
(Hebräerbrief 2, 14)
5. Trauer
- Wichtigkeit im Zusammenhang mit dem Tod
- verdrängte Trauer: psychische Probleme
5.1 Die natürliche Äußerung
von Trauer
Phasen der Trauerarbeit nach Kast 1982 (Iskenius-Emmler
1988)
1. Nicht-Wahrhaben-Wollen
- Gleichgültigkeit, Gefühllosigkeit, Starrheit
- Ambivalenz der Gefühle: a) Verbindung zum Verstorbenen
aufrecht erhalten, b) Ablösung nötig
- Individuation
2. aufbrechende Emotionen
- Zorn, Wut, Trauer, Angst, Ruhelosigkeit, Freude
- Zorn dem Schuldigen oder Verstorbenen gegenüber
- Suche nach dem Schuldigen, um eigene Hilflosigkeit
zu überspielen
- eigene Schuldgefühle
- Freude über erlebte Beziehung und Erinnerungen
3. Suchen und Sich-Trennen
- Suchen,
- um sich mit dem Verstorbenen zu beschäftigen,
um den Verlust verarbeiten zu können
- um die Beziehung in die eigene Persönlichkeit
integrieren zu können
- um an den Partner delegierte Aufgaben wieder
zurück zu nehmen
- eigene Verzweiflung akzeptieren
- emotionales Chaos, um alte Beziehungen zu beenden
und neue aufzubauen
- alle Erlebnisse mit dem Verstorbenen müssen
erzählt werden dürfen
4. neuer Selbst- und Weltbezug
- Freude am Leben, neue Beziehungen
- Verstorbener ist in die Persönlichkeit integriert
- neues Selbstbewusstsein, in dem Todesbewusstsein
Platz hat
5.2 Kindliches Trauerverhalten
Besonderheiten des kindlichen Trauerverhaltens
nach Iskenius-Emmler 1988:
- Kinder sind bei einem Verlust sehr sensibel bezüglich
der Umgebungsvariablen
- Kinder sind kaum in der Lage, längere Zeit ohne
eine wichtige Bezugsperson zu leben
- Kinder sind daher besonders auf die unmittelbaren
Betreuungspersonen angewiesen
nach Bowlby 1983 (Iskenius-Emmler 1988):
- Kinder haben anderes Verständnis von Gegebenheiten
wie Tod und Leben
- Kinder leben sehr stark in der Gegenwart, sind leichter
ablenkbar
- dementsprechend ist die Zeit, die sie sich intensiv
mit einem erlittenen Verlust beschäftigen, kürzer
nach Furman 1977 (Iskenius-Emmler 1988):
- Verlust eines Elternteils stellt Kinder aufgrund
der Besonderheit der Elternbindung vor eine unvergleichliche Situation
- Grundbedingungen für Trauerarbeit bei Kindern
nach Bodarwe 1989
- Beziehung zum Verstorbenen, deren Ambivalenz die
Liebe nicht erdrückt hat
- keine vollständige Identifikation mit dem Verstorbenen
- Akzeptanz des eigenen Todes wie des Todes des anderen
- alte, nicht verarbeitete Trauer darf nicht wieder
belebt werden
6. Krankheit und Tod
6.1 Unterscheidung: natürlicher Tod vs.
verfrühter Tod
- Verbindung des Todes mit dem Alter
- beim verfrühten Tod werden Menschen dazu gebracht,
sich mit ihrem eigenen Tod auseinander zu setzen
6.2 Todkranke Kinder und Erwachsene
Fünf Stadien bis zum Tod nach Kübler-Ross
1. Nicht-Wahrhaben-Wollen
- wenn Info zu früh oder von unbekanntem Menschen
kommt
- immer wieder bis zum Tod ist Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens
zu finden
2. Zorn
- Warum-Frage
- Entladung ist zufällig
- begründeter und unbegründeter Zorn
3. Verhandeln
- das Unvermeidliche hinausschieben
- Wunsch: Verlängerung des Lebens oder der Wunsch
nach Schmerzfreiheit
4. Depression
- Gefühl eines übermäßigen Verlustes
- erste Form ist reaktiv, zweite Form ist vorbereitend
5. Zustimmung
- kann erst eintreten, wenn alle anderen Phasen durchlaufen
sind
- gefühlsfreie Zeit
6.3 Todkranke Kinder und Erwachsene
- Kinder wissen sehr früh über ihren Zustand
Bescheid
- bei fehlenden Verbalisationsmöglichkeiten Ausdruck
über Bilder
- Initiative zum Gespräch geht bei Bedarf vom
Kind aus
- bei fehlenden Verbalisations- und Handlungsmöglichkeiten
geraten Kinder leicht unter Stress (dazu kommen Isolierung und Verlassenheitsängste)
Entwicklung der Todesvorstellung bei sterbenden Kindern
und Jugendlichen nach Daut 1990
Vorschulalter (0-5 Jahre)
- Kinder sind in ihrer Existenz total von den Eltern
abhängig
- kein Verständnis der Bedeutung des Todes
- ab dem 3. Lebensjahr Beschäftigung mit dem Thema
Tod
0-3 Jahre
- Einstellung zum eigenen Tod orientiert sich an
der Betroffenheit der Umwelt
- Angst im Krankenhaus vor allem vor Trennung von
der Mutter (nicht vor dem Sterben)
- zu Hause überträgt sich die Traurigkeit
und Ängstlichkeit der Eltern auf das Kind
2-4 Jahre
- Kinder entwickeln gerade ihr Ich
- dabei fällt auf, dass es auch ein Nicht-Ich
geben kann, ein Nicht-Sein
4-5 Jahre
- Ahnung, was der Tod für einen Menschen bedeutet
- Todesangst wird im Spiel oder in Bildern ausgedrückt
Grundschulalter (5-10 Jahre)
- Kind bemerkt, dass es ein bedeutungsvoller Teil der
Gesellschaft wird
- Kind ist von nun an nicht mehr nur Teil der Familie,
sondern auch Teil der Gesellschaft
- Eintritt in die Schule, daher neue Bezugspersonen
- große Angst vor Eingriffen im Krankenhaus (Kastrationsangst
- später auch Todesangst
- Kinder beginnen, den Tod zu verstehen
- Personifizierung des Todes
frühes Grundschulalter
- Kind erhält stabileres Bewusstsein, dass
es ein Individuum und eine einzigartige Persönlichkeit ist
- Kind kann über die Grenzen seines Ich hinaus
denken
- erlernt die Bedeutung der Zeit (auch Zukunft
und Vergangenheit)
- bei Beschäftigung mit der Zukunft entdeckt
es die Möglichkeit des Sterbens
- Überlegungen, wie das Leben nach dem Tod
weitergehen könnte
- naher Tod wird als Bestrafung anerkannt
spätes Grundschulalter
- durch Medien erfährt das Kind viel über
Todesfälle
- lernt, dass nicht nur ältere Menschen sterben
- Wissen über Endgültigkeit des Todes
- eigener Tod löst Verbitterung und Traurigkeit
aus
Jugendliche (10-15 Jahre)
- Ablehnung der elterlichen Kontrolle: Schuldgefühle
- naher Tod wird als Strafe für Ablehnung angesehen
- Ablehnung aller Bezugspersonen, von denen diese Strafe
ausgehen könnte
- Einsamkeit (auch in Beschäftigung mit dem Tod)
- Gefahr der Ablehnung durch soziale Gruppe
- Hilfestellung bei Schwächeren (Überforderung)
- Hilfe kann nur angenommen werden, wenn sie unauffällig
und selbstverständlich kommt
- ab dem 9. Lebensjahr ist können Bedeutung und
Funktion des Todes verstanden werden
- in der Pubertät ist der Tod faszinierend, da
er die tiefste Erfahrung des Lebens darstellt, der eigene Tod hingegen ist
löst große Angst aus
6.4 Kinder im Umgang mit dem Tod anderer
- Miteinbeziehung von Kindern ist wichtig
- kein Zwang zu bestimmten Tätigkeiten
- Geschwisterproblematik, da Eifersucht auf sterbende
Schwester/ sterbenden Bruder möglich ist
7. Abschließende Gedanken
- Möglichkeit, Kinder in der Schule zu konfrontieren,
ohne sie zu überfordern
- Möglichkeit, betroffene Menschen zu verstehen
- Anleitung, sich selbst Gedanken zu machen
8. Literatur
zur Literaturliste
|
Klausur zu diesem Thema:
|

(als
gezippte pdf-Datei ca. 30 kb)
|